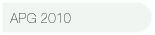 |
 |
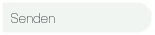 |
 |
 |
 |
| Impulsvortrag von P. Klaus Mertes SJ, Berlin |
 Impulsvortrag von P. Klaus Mertes SJ, Berlin: „Aber ihr werdet die Kraft des Hl. Geistes empfangen ...“(Apg 1,8) |
Teil 1„Krise – Zeit der Unter scheidung, der Erkenntnis und des Wandels“ Wien, 3. Diözesanversammlung im Stephansdom, 14.10.2010 P. Klaus Mertes, SJ Der See Genezareth befindet sich in einem Kessel. Die Winde stapeln sich an der Außenseite der Berge so lange hoch, bis sie sich über die Böschung begeben, um sich dann plötzlich nach unten zu ergießen. Plötzlichkeit gehört zur Erfahrung des Sturmes. Sturm überrascht. Sie haben mich eingeladen, um nicht nur, aber auch von meinen Erfahrungen der letzen Monate her über den Sturm zu sprechen, darüber, wie man in diesem Sturm die Geister unterscheiden kann, und welche vielleicht sogar überraschenden gesamtkirchlichen Perspektiven darin zu entdecken sind. 1. Lassen Sie mich zu Beginn ganz kurz sagen, was ich in der Tradition der Exerzitien des Heiligen Ignatius von Loyola unter der Unterscheidung der Geister verstehe. Mit „Geister“ meine Ignatius Bewegung (motus), innere Reaktionen auf Ereignisse und Eindrücke aller Art. Bekannt ist das Beispiel von Ignatius selbst. Er liegt nach seiner Verwundung auf dem Krankenbett in Loyola und liest mangels besserer Alternative Ritterromane. Anfangs vertreiben sie ihm die Langeweile, aber beim Rückblick auf die Lektüre stellt sich ein schales Gefühl ein. Umgekehrt verhält es sich mit den Heiligengeschichten, insbesondere denen über den Heiligen Franziskus und den Heiligen Dominikus, und mit der Vita Christi des Ludolf von Sachsen. Es kostet ihn anfangs Überwindung diese zu lesen, doch rückblickend fühlt er sich inspiriert und entdeckt neue Perspektiven für sich. Bedeutungsvoll an diesem Prozess ist, dass er diese „Geister,“ die inneren Reaktionen entdeckt und beginnt, sie zu reflektieren. Sein Wort für „reflektieren“ lautet: „schmecken“ oder auch „kosten.“ Der Geist spricht auch heute. Er sagt nicht immer nur das, was er immer schon gesagt hat. Dies ist eine Option hinter der Lehre von der Unterscheidung der Geister. Bei Ignatius führt das ein Leben lang immer wieder zu neuen Aufbrüchen. Auch in der Apostelgeschichte wird dieses Prinzip ebenfalls deutlich. Der Geist spricht zu Paulus und sendet ihn zu den Völkern. Damit sagt er etwas Neues. Der Konflikt, der in der Apostelgeschichte beschrieben wird und in den paulinischen Briefen durchscheint, wäre ja gar nicht verständlich, wenn es dabei nicht um etwas Neues, sondern um etwas Allen Altbekanntes gegangen wäre. Und dieses Neue schickt auch ihn auf eine große Reise. Der Geist spricht nicht nur durch die Ereignisse, die gut schmecken, sondern auch durch bittere Ereignisse. Das ist die zweite Erkenntnis aus der ignatianischen Lehre der Unterscheidung der Geister. Zwar führt der Geist am Ende immer zu einer größeren Freude, einem größeren Frieden und einer größeren Liebe – und ist auch daran zu erkennen. Aber das bedeutet nicht, dass der Einstieg des Geistes in meine Erfahrungswelt süß und angenehm schmecken muss. Sturm ist ein unbequemes Ereignis. Reue schmeckt nicht süß. Ignatius gefällt die geistliche Lektüre zu Beginn ebenfalls nicht. Paulus hat seitdem einen „Stachel im Fleisch.“ Doch in der bitteren Erfahrung lässt sich das Süße herausschmecken, darin der Geist zu mir spricht. Gott lässt sich in allen Dingen, in allen Ereignissen suchen und finden, auch im Sturm. Mehr noch: Gerade im Sturm muss es um mehr gehen als darum, zu überleben. Es geht im Sturm darum, das Wirken, das Sprechen des Geistes im Sturm zu erkennen. Vermutlich verhält es sich sogar so: Wer dem Sturm nur defensiv gegenübertritt – in der bloßen Absicht zu überleben – der geht unter. Schließlich gehört zur Unterscheidung der Geister Freiheit. Die Fähigkeit zu schmecken, die Fähigkeit zur Reflexion setzt innere Freiheit voraus. Markus Gehlen hat dazu in seinem Vortrag zur zweiten Diözesanversammlung schon Eentscheidendes gesagt,. In diesem Zusammenhang benutzt Ignatius gerne das Bild der Waage: Wer die Geister unterscheiden will, muss sich in die Mitte seiner Seelenwaage begeben, also an die Stelle der Waage, an der er das Ergebnis der Wägung gerade nicht selbst beeinflussen kann. Sich in der Mitte der Waage zu befinden bedeutet, frei zu sein – sich nicht von dem bestimmen zu lassen, was in den inneren oder äußeren Stürmen her von außen her oder von innen her Druck macht: Angst, Unbeweglichkeit, Rechthaberei, institutionelle Interessen, Drohungen, Launen und Moden. Auch in der gegenseitigen Begleitung in geistlichen Erkenntnisprozessen geht es nicht darum, andere dazu zu führen, dass sie erkennen was ich will, dass sie erkennen. Vielmehr geht es darum, anderen dabei zu helfen, dass sie selbst erkennen, was Gott ihnen sagen will. Alles weitere ergibt sich daraus. 2. Wenn ich halb rückblickend, halb noch im Sturm stehend versuche zu systematisieren, was ich an Perspektiven für den Weg der Kirche sehe, dann fallen mir mehrere Punkte ein. Erstens: Der Sturm hat aufgedeckt, und zwar in mehreren Dimensionen: zum einen die Missetaten einzelner Täter. Zum zweiten das Versagen von Institutionen, Familien und „Systemen,“ in denen die Opfer lebten und versuchten zu sprechen – durch Weghören, Versetzen der Täter und vergessen der Opfer. Schließlich hat der Sturm uns dadurch mit der Perspektive der Opfer bekannt gemacht, wie sie von ihrer Missbrauchserfahrung her auf ihre kirchliche Erziehung und Prägung blicken – weil wir ihnen zuhören mussten, zuhören durften. Ich gehe davon aus, dass die Perspektive der Opfer vom Evangelium her eine besondere theologische Würde hat. Die Option der Armen ist eine Option für die Opfer. Christus identifiziert sich mit den Kindern, insbesondere mit den geschundenen „Geringsten unter den Brüdern und Schwestern.“ Das ist mehr als nur eine Metapher, um der moralischen Pflicht zu helfen Nachdruck zu verleihen. Es ist eine geistliche Option. Bei der Begegnung mit den Armen geht es um die Begegnung mit Christus. Die Armen, die Opfer sind der „Ort,“ an dem ich die Stimme Christ, die Stimme des Geistes hören kann. Die Option für die Armen ist nicht bloß eine Option für Das Helfen, sondern eine Option für das Zuhören, und zwar: den Armen, den Opfern zuhören. Was erzählen uns die Opfer? Ich kann Ihnen hier nur das berichten, was mich aus dem Hören der Opfer heraus nachhaltig nachdenklich gemacht hat: Opfer berichten, was an der kirchlichen Sexualpädagogik ihnen erschwert hat, mit der Erfahrung sexualisierter Gewalt zu leben: sich als Todsünder und Verdammte fühlen, wenn es zum Beispiel im Rahmen eines sexuellen Missbrauchs zu Handlungen gekommen ist, bei denen sie auch Lust empfunden haben. Andere Opfer erzählen, dass sie mehr Kraft gehabt hätten, sich gegen die Übergriffe zu wehren, wenn sie eine Sprache zur Verfügung gehabt hätten, mit denen sie die Übergriffe benennen konnten – ein zentraler Hinweis für die Prävention! Andere berichten, dass sie den Täter überhaupt erst als Täter in den Blick benehmen – und sich als Opfer erkennen – konnten, als sie ihr überzogenes Priesterbild hinter sich ließen.
Den Opfern zuzuhören bedeutet nicht, ihnen in allem Recht zu geben, und immer die Konsequenzen zu ziehen, die sie wollen. Der Wille der Armen, der Wille der Lleidenden ist nicht identisch mit dem Willen Gottes. Doch der Wille Gottes lässt sich nicht finden ohne die Begegnung mit den Leidenden, mit den Opfern. Das erfordert Zuhören – das nebenbei auch mehr hilft als Helfen-wollen. Hier spricht der Sturm als erster Hinweis für den Weg, der für die Kirche zu gehen wäre: Ein Weg zu den Armen, um ihnen zuzuhören.
2.2. Der Sturm der Anklage Die Opfer klagen die Kirche an. Man könnte ihnen antworten, dass die Kirche gar nicht angeklagt werden kann, weil es nur Einzeltäter gibt, die Kirche als Ganzes aber heilig , also frei von Sünde sei. Mir scheint das keine ausreichende Antwort auf die Anklage zu sein, weil sie den doppelten Charakter des Missbrauchs übersieht. Man könnte den anklagenden Opfern auch sagen, dass sie nur Einzelstimmen sind, und andere Opfer gar nicht anklagen. Doch damit werden Opfer gegen Opfer zum Zwecke der eigenen Entlastung in Stellung gebracht. Eine Anklage ist nicht nur dann berechtigt, wenn sie von allen Betroffenen kommt. Der Sturm bläst die Kirche also in eine bestimmte Richtung, und zwar in Richtung Anklagebank. Auf der Anklagebank Platz zu nehmen bedeutet für die Kirche, vertraute Selbstbilder hintanzustellen. Dieser Prozess ist noch nicht abgeschlossen. Es geht um einen grundlegenden Positionswechsel. Bei den Missbrauchsopfern begegnet der Orden, die Gemeinde, die Kirche sozusagen den Opfern ihrer eigenen Pastoral. Sie steht als Sünderin da, und zwar nicht nur vor Gott, sondern auch vor den Opfern. Es ist nicht leicht, diesen Platz einzunehmen. Für mich war der Zeitpunkt gekommen, Ja zu dieser Positionsbestimmung zu sagen, als die Entschädigungsforderungen laut wurden. Zu meiner nachträglichen Überraschung verdanke ich diese Positionierung auf der Sünderbank einer wesentlichen Einsicht: das Ziel des Prozesses zwischen Opfer und Kirche ist nicht etwa Wiederherstellung der Glaubwürdigkeit der Kirche, Beruhigung der Opfer oder ähnliches, sondern: Versöhnung. Zur Versöhnung gehören zwei, die sich aufeinander zu bewegen, Opferseite und Täterseite. Es eröffnet sich also die Perspektive der Versöhnung, die Möglichkeit, etwas Aktives für die Versöhnung zu tun. Man könnte es auch so sagen: die Opferseite erwartet von der Kirche, dass sie sich auf sie zu bewegt und nicht umgekehrt. Eine Frau, die von einem inzwischen verstorbenen Mitbruder in den 60er Jahren als Berufsschülerin sexuell missbraucht wurde, wandte sich an mich. Sie wünschte, dass ich zu einem Gespräch mit ihr und ihrem Mann nach Karlsruhe fahre. Das sind von Berlin aus sieben Stunden Anfahrt. Meine Bitte, ob sie nicht nach Berlin kommen könnte, da ich die Zeit und Kraft nicht aufbringen könnte für diese lange Reise, schlug sie aus und wies mich auf die Möglichkeit hin, sie in den Ferien zu ihr zu kommen. Ich opferte also wohl oder übel einen Ferientag für die Reise. Das Gespräch dauerte eine knappe Stunde und war nicht leicht. Als ich zurück in Berlin war, erhielt ich einen Brief, in dem sich die Frau herzlich für das Gespräch bedankte und mir erklärte, wie wichtig es für sie gewesen sei, dass nicht sie zu mir kommen musste sondern ich zu ihr. Es hatte ihr geholfen, in der Versöhnung mit Orden und Kirche einen Schritt weiter zu kommen. Als Nächstes will sie mich nun in Berlin besuchen. Versöhnung, das ist die Botschaft der Kirche an die Menschheit. Der Sturm der Anklage gibt der Kirche nun die Möglichkeit, Versöhnung ohne Selbstgerechtigkeit vorzuleben. Es gehört doch zu den tiefen Ursachen von Gewalt und Unversöhnlichkeit zwischen Völkern und Menschen, dass sich alle immer als Opfer definieren und keiner der Beteiligten es zulassen kann, sich auf der Täterseite zu sehen. Die verfestigten Opfermythen machen Versöhnung unmöglich, die Unfähigkeit von Menschen, sich als Sünder zu sehen, die Unfähigkeit von Völkern, Verantwortung zu übernehmen für Gräueltaten, die in ihrem Namen und in ihrem Interesse begangen wurden. Wenn die Kirche gerade darin voranschreitet, Ja zu sagen zur eigenen Verantwortung für das Falsche und Schlimme, das in ihrem Namen geschehen ist, dann kann sie auch zu einer glaubwürdigen Anwältin der Versöhnung zwischen Menschen und Völkern werden. Der Sturm macht die Kirche auf ihren Auftrag zum Dienst an der Versöhnung aufmerksam.
2.3. Der Sturm des Hasses Zu der Erfahrung des Sturmes der letzten Monate gehört auch die Erfahrung des Hasses. Ich rede nicht über die innerkirchlichen Schlammschlachten, die Selbstzerfleischung an Deck, mitten im Sturm, sicherlich eine helle Freude für den „bösen Feind der menschlichen Seele.“ Es geht mir mehr um die Verletzungen, die der Sturm mit sich bringt. Die Verletzung meiner Liebe zur Kirche durch hasserfülltes Sprechen über die Kirche. Das Misstrauen, das trotz aller gegenteiligen Bemühungen auf der Opferseite bleibt. Die Verdächtigung der guten Intentionen. Das Ausschlagen der Versöhnungsgesten. Der Hass der Opfer – oder, um nicht zu moralisieren, denn ich verbinde diese Feststellung nicht mit einem Vorwurf: die Hassgefühle in den Opfern gehören zur Opfererfahrung dazu. Der Hass wehte mir in den letzten Monaten manches Mal entgegen. Aber auch der Hass anderer, die sich den Sturm mit dranhängten-meist übrigens auch wieder mit eigenen Opfergeschichten im Hintergrund. Die Begegnung mit Hass birgt die Versuchung in sich, sich von dem Hass anstecken zu lassen, beleidigt auf den Tisch zu hauen und zurückzuschlagen. Das Evangelium kennt eine andere Art und Weise, mit dem Hass umzugehen. Der Sturm führt die Kirche in jene Situation hinein, die Christus in der Bergpredigt benennt:“Wenn Dich einer auf die rechte Wange schlägt, dann halte ihm auch die Wange hin.“ Der Hass ist eine Gelegenheit, die Feindesliebe zu leben, wie Christus die gepredigt und gelebt hat. Was kann das bedeuten, die andere Wange hinzuhalten? Es bedeutet auf jeden Fall nicht, sich zurückzuziehen und klein beizugeben-selbst wenn es manchmal aus Selbstschutzgründen sinnvoll sein kann, eine Phase der Distanz einzulegen. Die andere Wange hinhalten heißt: Sich nicht abwenden, sondern innerlich der Welt zugewandt bleiben, auch dann, wenn mir Hass entgegenschlägt. Hass ist ja nichts anderes als altgewordener Zorn, unter dem Opfer selbst auch leiden. Hass ist nicht nur zerstörerisch, sondern auch selbst-zerstörerisch. Wenn ich zugewandt bin, kann ich mich dann auch auf zugewandte Weise abgrenzen. In der Abgrenzung kann dann deutlich werden, dass die Kirche auch den Opfern etwas zu sagen hat, auch dann, wenn sie auf der Anklagebank sitzt. Die Kirche ist eben mehr als nur Sünderin. Das Sichtbarwerden des Hasses ist eine Gelegenheit, den Täter-Opfer-Kreislauf zu unterbrechen. Es gibt eine Möglichkeit, Hassgefühlen so zu begegnen, dass sie nicht anstecken, sondern ihre Macht dadurch verlieren, dass man sie aushält ohne innerlich einzuknicken. Das ist eine ganz reale Hoffnung für die Welt. Von ihr darf und soll die Kirche sprechen, vor allem dadurch, dass sie diese Hoffnung lebt.
2.4. Der Sturm des Wandels Der Sturm verändert. Es gibt ein „vor dem Sturm“ und ein „nach dem Sturm“. In der Regel ist nach dem Sturm nichts mehr so wie vor dem Sturm. Das gilt auch für die gegenwärtigen Wandelungsprozesse in der Kirche. Die Kirche wird in 10 Jahren anders aussehen als heute. Eines Tages werden wir zurückblicken und uns wundern, was sich alles verändert hat, mehr als wir selbst imitiert haben-was natürlich kein dafür Grund ist, nichts pro-aktiv zu initiieren. Im Sturm stellt sich die Frage: Was muss ich bewahren, und was ich loslassen? Die Frage kann falsch verstanden werden. Schnell kommt es dann zum Diskurs der gegenseitigen Abwertung, so als wäre das, was man loslassen muss, immer schon überflüssiger Tand gewesen, während das, was bewahrt werden soll, dass „Eigentliche, Wichtige“ sei. Nein, es geht im Sturm um mehr als nur darum, überflüssigen Ballast loszulassen. Man muss auch Kostbares loslassen, und das fällt gerade dann besonders schwer, wenn andere um einen herumstehen und einzureden versuchen, dass das eigentlich gar nicht wertvoll sein, was man da jetzt loslassen solle. Manches Wertvolle muss man loslassen, weil der Sturm es einem ohnehin wegnimmt. Es steht nur noch die Frage an, ob man angeklammert an das Wertvolle, mit über Bord gehen will, oder ob man an Bord bleibt und sich weiter mit dem Navigieren des Schiffs befasst-worin ja die eigentliche Aufgabe besteht, die uns anvertraut ist. In Wandlungsprozessen gibt es immer suizidale Tendenzen, das Abdriften in Sonderwelten, den sehnsüchtigen Blick in die guten alten Zeiten vor dem Sturm, die Verweigerung der Wahrnehmung von Wirklichkeit, den Abschied von der Verantwortung für das Ganze. Hier haben Widerspruch und Mahnung durchaus Sinn, um dem anderen oder der anderen zu helfen, an Bord und damit in der Realität zu bleiben. Manchmal muss man Wandel zulassen, um sich selbst, dem anderen und der Wirklichkeit treu zu bleiben. Das gilt für zwischenmenschliche Beziehungen ebenso wie für die Gestalt der Kirche und für das Verhältnis des Menschen zu Gott. Das Unterscheidungskriterium für den Wandel ist diese Treue zur Wirklichkeit. Gott ist nicht in virtuellen Welten Mensch geworden, sondern in der Wirklichkeit. Wer also Gott suchen undfinden will in allen Dingen, muss in der Wirklichkeit bleiben und sie anerkennen als den Ort, in dem Gott begegnet. 3. Von jeher hat mich der Anblick des schlafenden Jesus mitten im Sturm berührt. Das Markusevangelium fügt sogar das liebevolle Detail hinzu, dass er auf einem Kopfkissen lag und schlief, während die Jünger in Panik und aufgebracht versuchten zu retten, was zu retten war. Wer hat ihm dieses Kopfkissen mitgegeben? Ein Freund, eine Freundin, seine Mutter? Hat er für sich selbst gesorgt? Mich erfreut der Gedanke, das Jesus in seinem sicherlich nicht reichlichen Handgepäck Platz hatte für ein Kopfkissen, und dass er mitten im Sturm sein Haupt darauf bettete. Was ist für mich dieses Kopfkissen? Da kann ich vieles nennen. Meine Freude an der Kirche, die ich mir niemals nehmen lassen werde. Das Glück, dem Evangelium begegnet zu sein, dessen Weisung mich durch den Sturm leitet und aus dem Sturm rettet. Meine Hoffnung auf das Reich Gottes, um das ich zusammen mit Jesus das Vater Unser beten darf. Der Blick auf Gottes Barmherzigkeit, der mir alle Angst nimmt, als Sünder sichtbar zu werden. Die Unterscheidung der Geister, die es mir ermöglicht, in der Aufklärung die Wahrheit, in der Anklage die Chance zur Versöhnung und im Hass die Gelegenheit zu jener liebevollen und zugleich abgrenzenden Zugewandtheit zu entdecken, die den Kreislauf der Gewalt unterbricht. Ich schließe meine Betrachtung mit dem Hinweis auf Paulus. Er schläft zwar nicht wie Jesus mitten im Sturm, aber seine Souveränität im Umgang mit Seesturm und Schiffbruch vor Malta zeigt etwas von dieser inneren Ruhe, die sich aus der Gründung in der Liebe Gottes ergibt. Auch sie wird durch den Sturm sichtbar. Der Sturm hat dieselbe Funktion wie das Feuer: Es läutert und schleift den Diamanten, bis er strahlt.
Teil 2Reaktion bzw. Beitrag nach einer Phase des offenen Miko: Ich werde jetzt nicht 40 Minuten lang extemporieren, sondern einfach nur auf das reagieren, was ich gehört habe und wo ich das Gefühl habe vielleicht noch etwas beitragen zu können. Hier ist, wenn ich das richtig verstanden habe, soweit ich die österreichische Situation kenne, aufmerksam gemacht worden auf die Problematik der Abschiebung, die zurzeit sehr virulent ist. Ich muss sagen, dass ich persönlich mich im Rückblick nachträglich auf die Problematik des Missbrauchs vorbereitet gefühlt habe durch zwei Jungens im Alter von 10 und 12 Jahren, die vor 10 Jahren an der Schule, in der ich bin, anklopften und fragten, ob sie bei uns Schüler sein könnten. Die beiden Jungen waren illegal in Deutschland. Sie waren über mehrere Jahre in Berlin gewesen, das Asylverfahren war zum Schluss abschlägig beschieden worden und sie mussten dann zurück in ihr Heimatland, zusammen mit ihrer Mutter. Dort waren die Verhältnisse so schrecklich - das war ja der Grund warum sie geflohen waren - dass sie dann heimlich zurückgekommen sind, durch die Neiße geschwommen sind und dann in Berlin im Kirchenasyl waren. Und die beiden Jungs sprachen hervorragend Deutsch, hatten sich wunderbar integriert. Illegale sind übrigens die Ausländer, die am „unproblematischsten“ sind, weil sie ja Angst haben, aufzufallen und dadurch entdeckt zu werden. Und nun kam aus dem Kirchenasyl die Frage an mich, ob ich bereit wäre die Schule für Illegale zu öffnen. Das war für mich nachträglich gesehen ein Anklopfen des Heiligen Geistes an die Tür unserer Schule, unseres Kollegs; denn die Frage löste bei mir sofort massive Ängste aus. Was mache ich, wenn ich jetzt die Schule für Illegale öffne? In Berlin ist es so, dass die Gesetzgebung des Staates sehr privatschulfeindlich ist. Wenn das entdeckt wird, dann gefährde ich am Ende die Existenz der Schule, ich ernte eventuell einen riesigen Konflikt in der Elternschaft, in der Schülerschaft und so weiter. Ich hab dann einen Kollegen zu Rate gezogen, der selbst eine Flüchtlingserfahrung hat, und der sagte mir Folgendes: wenn ein Bettler an meiner Tür um ein Stück Brot bettelt, dann frage ich nicht: "Hast du einen Pass?". Und wenn Jugendliche darum bitten, lernen zu dürfen, dann frage ich das auch nicht. Bildung ist ein Menschenrecht, und dieses Menschenrecht muss auch ihnen zugestanden werden. Und dann haben wir die Schule für Illegale geöffnet und das hat die Schule langfristig sehr verändert. So ähnlich geht es mir im Grunde genommen mit den Missbrauchsfragen und dieser gewaltigen Welle, die losgetreten worden ist. Was habe ich getan? Ich habe ja nicht mehr getan als drei ehemaligen Schülern zuzuhören, die Mitte Januar zu mir kamen. Es waren drei Personen, und aus dem was sie mir erzählten, schloss ich, es muss also allein bei dem einen Pater aus den 70er/80er Jahren mehr als 100 Opfer an meiner Schule geben. Da stellte sich natürlich die Frage nach der angemessenen Reaktion. Die schien für mich zu sein: ich schreibe einen Brief an die betroffenen Jahrgänge. Natürlich habe ich damit gerechnet, dass das an die Presse geraten könnte, dachte dabei allerdings, das gibt dann ein paar Blasen in der lokalen Presse, dann wird sich das wieder beruhigen. Aber es waren im Grunde nur drei Personen, denen ich zuhörte. Das heißt, hier gibt es eine ganz interessante Korrespondenz: Es fängt konkret an mit einer ganz kleinen Begegnung und am Ende geht ein Sturm über Europa. So ähnlich: es sind zwei kleine Jungs, die an unserer Schule lernen wollen, die illegal sind, keine Papiere haben. Ich öffne ihnen die Schule und am Ende verändert dieser Vorgang das Ganze! Deswegen finde ich es so zentral und so wichtig für uns als Kirche, dass wir immer wieder ganz konkret werden, ganz konkret etwas anfangen, dass wir in unseren Planungsüberlegungen, die natürlich auch immer die Dimension der Verwaltung, der Statistiken, der Zahlen haben müssen, dass wir uns nicht darauf fixieren, dass wir uns auch nicht dauernd von Statistiken und anderen Zahlenkonstruktionen die Wirklichkeit erklären lassen, sondern dass wir - dies natürlich Alles mit zur Kenntnis nehmend - immer wieder ganz konkret werden. Ich glaube, dass hier auch etwas vom Prinzip der Inkarnation erfahrbar und deutlich wird. Wie verändert Gott die Welt? Dadurch, dass er in einer armen Familie in einem Stall Mensch wird. Irgendwo ganz einfach und klein anfängt. Theologisch ist das die unaufgebbare Einheit zwischen Partikularität und Universalität. Beides gehört eben zusammen. Es gibt eine falsche Universalität auch in unserem Denken und Planen, und es gibt eine falsche Partikularität. Für uns als Kirche bedeutet es eben wirklich, dass wir uns auf konkrete Geschichten einlassen – wenn Jugendliche ohne Pass an einer Schultür anklopfen oder wenn Missbrauchsopfer sich zu Wort melden. Es ist in diesem Beitrag ein zweites großes Thema genannt worden, wiederverheiratete Geschiedene. Ein Mitbruder von uns ist in Berlin zuständig für die Rückkehr von Menschen in die katholische Kirche. Ich weiß von ihm, dass es unglaublich viele Menschen gibt, die in den 60er und 70er Jahren aus der Kirche ausgetreten sind und jetzt in Altern von 50, 60 zurückkommen. 80% von ihnen sind in dem Moment, wo sie in die Kirche wieder eintreten, zunächst einmal exkommuniziert, weil es ein Problem mit ihrer Ehe gibt. Ich spreche oft mit den Mitbrüdern darüber, was man da machen kann. Dies ist auch so eine ganz konkrete Erfahrung, die etwas Drängendes hat und wo auch irgendwann der Punkt kommt, an dem wir eine Antwort finden müssen. Wann und wie, das weiß ich nicht, aber da ist ein Drängen, das ein bisschen ähnlich ist wie das Anklopfen von Illegalen an die Tür der Schule oder das Sprechen dieser drei Opfer im Januar, das die Tsunamiwelle ausgelöst haben. Da muss etwas kommen, da drängt etwas und wir müssen uns diesem Drängen mit dem unterscheidenden Geist öffnen.
Ich möchte einen zweiten Punkt aufgreifen: Es ist gefragt worden, was sollen wir mit den Kreisen tun, die sich völlig verschließen und meinen, der Kardinal sei auf Abwegen? Sehr oft habe ich in den letzten Monaten an das Wort Jesu aus dem Lukasevangelium denken müssen: „Ich bin nicht gekommen, um Frieden zu bringen, sondern Spaltung." „Schwert“ übersetzt Luther. Was ist das für ein erstaunlicher Satz! Ich verstehe ihn nicht so, dass Jesus in der Absicht gekommen ist, zu spalten. Also: „Ich bin gekommen, um zu spalten.“ Mit der Intention zu spalten. Sondern Jesus verkündet das Evangelium und merkt, dass das Evangelium in der Wirkung spaltet. Schwiegervater und -sohn, Schwiegermutter und -tochter, Geschwister untereinander usw.
Dieses „um zu“ -Ich bin nicht gekommen, um Frieden zu bringen, sondern um zu spalten - ist also nicht ein „um zu“, welches seine Intention, sondern seine Wirkung beschreibt. Ich stelle mir manchmal Jesus vor, dass er selbst erschrocken vor der Wirkung seines Evangeliums steht und diesen Satz auch irgendwo mit Schrecken sagt. „Ich bin offensichtlich gekommen, um zu spalten.“ Das ist so ähnlich, dieses „um zu“, wie wenn ich sagen würde, „ich bin nach Berlin gekommen, um Monika kennen zu lernen“, die heute meine Frau ist. Natürlich bin ich nicht nach Berlin gekommen, um Monika kennen zu lernen, sondern um zu studieren. Informatik. Und da hab ich Monika kennen gelernt und im Rückblick entdecke ich, der eigentliche Sinn meines Kommens war nicht mein Studium, sondern das Kennenlernen von Monika. Ich bin nicht gekommen, um zu studieren sondern um Monika kennen zu lernen. Ich bin nicht gekommen um Frieden zu bringen - das war meine Absicht -, sondern um zu spalten. Also aus dem Rückblick erkenne ich, dass ich spalte, und jetzt erkenne ich, dass diese Spaltung einen Sinn hat, eine innere Logik, die ich im Rückblick entdecke. Ich erkenne, dass dahinter ein Auftrag war; der liebe Gott hat mir sozusagen erspart, es vorher zu sagen, dass ich, wenn ich nach Berlin komme, Monika kennen lernen werde. Er hat es mir erspart, damit ich die neue Stadt ganz offen betreten kann – in gewisser Weise eine Voraussetzung dafür, um Monika überhaupt kennen lernen zu können. Und so hat Gott Jesus erspart, als er sein Friedensevangelium verkündete, dass er schon vorher wusste: "Ich werde damit spalten." Aber er hat gespalten und er muss dieses Spalten anerkennen. Das ist ein ganz anderes Spalten als das zuspitzende Spaltens der Rechthaberei. Es ist ein Spalten, das sich aus der Erfahrung ergibt, dass ich den Willen Gottes, nachdem ich ihn gespürt und erkannt habe, auch tue, und nun finde ich auch in meinen inneren Kreisen eben nicht nur Zustimmung, sondern auch Kritik, Menschen die sich mir verschließen. Das andere Beispiel ist Paulus. Wenn man die Paulusbriefe liest, geben sie doch Zeugnis von einer Spaltung. Nicht von einer Spaltung, die er intendiert hat, aber von einer Spaltung, die sein Wirken, Taufen von Nichtjuden in der Judenchristen- Urgemeinde bewirkt. Und derjenige, der eine Entscheidung trifft, in der er nach Prüfung seines Gewissens vor Gott sagt: "Das ist das, was ich von Gott her hier zu tun habe und tun muss", und der dann dadurch die Erfahrung macht zu spalten, ist kein Spalter. Man kann auch, wenn man einmal diesen Weg gegangen ist und durch das, was man getan hat, in der Wirkung gespalten hat, nicht mehr zurücktreten und sagen „Oh, ich habe vielleicht doch einen Fehler gemacht und ich taufe jetzt in Zukunft keine Nichtjuden mehr“ oder „ich verkünde das Evangelium vom Reich Gottes ein wenig softer.“
Natürlich muss ich immer auch in der Art und Weise, wie ich spreche, die Einheit im Blick haben, aber es gibt Situationen, in denen ich das aussprechen muss, was ich auszusprechen habe vor Gott und vor den Menschen, und dann muss ich dazu stehen. Ich glaube, dass dann die Situation gegeben ist, in der der Einheit des Ganzen nur noch dadurch gedient werden kann, dass ich zu dem stehe, wodurch ich, ohne es zu wollen gespalten habe, um es dann natürlich in den größeren innerkirchlichen Diskurs einzubringen. Das wusste Paulus ja auch. Paulus wusste, dass er vergeblich taufen würde, vergeblich laufen würde, wenn er nicht die Zustimmung der Säulen in Jerusalem bekommen würde. Und deswegen ist auch der Hinweis auf das Apostelkonzil, der heute hier gefallen ist, so wichtig. Das Apostelkonzil ist ja genau jener Ort, an dem dann die Sendung des Paulus, die von ihm her eine Sendung Christi war, und die er als solche bezeugte, von der Gesamtkirche bestätigt wird als eine tatsächliche Sendung Christi. Das bedeutet wiederum, dass die erste und wichtigste Aufgabe des Amtes in der Kirche ist, zuzuhören. Dafür ist die Apostelgeschichte, finde ich, ein wunderbares Beispiel. Amt muss, wenn es führen will, hören. Und dann mit der amtlichen Autorität, die es hat, auf das Gehörte reagieren. Aber am allerwichtigsten ist zunächst einmal das Hören. Es muss darauf hören, dass Paulus sagt "Ich bin vom Herrn her zu den Völkern gesandt“, obwohl einige aus dem Kreise der Jünger noch die Worte des vorösterlichen Jesus im Ohr haben, der ihnen sagte "Geht nicht zu den Heiden und geht nicht zu den Samaritern, sondern geht nur zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel!" Und dieses hörende Amt muss dann auch sein Verhältnis zu Christus von dem her, was es hört, über Paulus neu hören und sich bereichern und anreichern lassen. Es gibt einen Artikel eines Theologen namens Erik Peterson, den ich mehr als alles andere empfehlen kann, um vielleicht auch einen solchen Prozess zu begleiten, einer über die Kirche, in dem er genau diesen Prozess beschreibt und sagt, vor welcher Entscheidung die Urkirche in der Apostelgeschichte stand. Sie stand vor der Entscheidung, ob sie letztlich nicht mehr als eine Gruppe von Menschen, die sich auf die Worte des vorösterlichen Jesus beziehen, sie durch die Zeit hindurch trägt, oder ob sie sich dem Sprechen des auferstandenen Herrn in der Kirche öffnet, der dem Paulus etwas sagt, was er vorher nicht gesagt hat. Und nur dadurch wird natürlich die Kirche zu einer Kirche, die tatsächlich als pilgernde Kirche durch die Geschichte wandern kann und eben nicht einfach nur als eine kulturelle Konserve durch die Geschichte sich hindurch trägt. Die Spaltung, die eine Entscheidung, auch die Entscheidung eines Kardinals, in einer Diözese bewirken kann, muss nicht ein Zeichen dafür sein, dass das, was entschieden worden ist, nicht im Geist des Evangeliums ist, sondern kann auch ein Zeichen dafür sein, dass es sehr wohl in diesem Geiste ist. Und dann muss der Streit, der darum entsteht, hineingetragen werden in die ganze Kirche. „Was machen wir mit denen die sich abwenden?“ war die Frage. Es gibt einen Punkt, an dem ich zulassen muss, dass sich die Abwendenden abwenden. Und indem Maße, in dem ich die Tür offen halte für diejenigen, die sich abgewandt haben, und sie nicht innerlich abschreibe, bleibt die Tür offen zum Zurückkehren. Ich möchte einen weiteren Punkt ansprechen, der mir auch sehr wichtig zu sein scheint: heilende Liturgien für Opfer. Mehr geben als nur Geld. Auch dies ist ein ganz wichtiger Punkt, ich habe oft umgekehrt von Opfern gehört, „Wir wollen Geld. Und wir wollen nicht, dass ihr Bußgottesdienste macht, das ist mir alles nicht wichtig. Und wir wollen Geld.“ Ich glaube, dass man Geld und andere Dinge eben nicht gegeneinander ausspielen kann. Zahlen ist eine Weise, wie man anerkennen kann, dass Schmerzen zugefügt worden sind. Zahlen ermöglicht mir natürlich auch, vor den Opfern aufzustehen und zu sagen: „Das Zahlen hat von mir her einen Sinn, den ich nicht bloß und einfach in einer Entschädigung sehe. Denn das was dir angetan worden ist lässt sich ja gar nicht entschädigen durch solche einen Beitrag. Sondern das Zahlen ist ein Zeichen dafür, dass ich auf dich zugehen will und die Versöhnung im Blick habe.“ Dadurch dass ich diese Versöhnung, von der ich auch vorhin sprach, im Blick habe, eröffne ich ja vielleicht einigen Opfern, die die Versöhnung noch gar nicht im Blick haben, die Möglichkeit, diese Versöhnungsperspektive wieder in den Blick zu nehmen. Und dann ist der Wunsch nach Versöhnung bei von Menschen, die durch die Kirche geschädigt worden sind, wiederum für die Kirche ein großes Geschenk, ein wunderbares Geschenk. Es gibt einen Zynismus auch kirchlicherseits der da lautet: "Die Opfer haben wir für die Kirche verloren, die sind alle zornig und wütend, die versammeln sich in Selbsthilfegruppen, wo sie sich mit ihren ekklesiogenen Neurosen befassen, die interessieren uns nicht mehr, wir suchen jetzt neue Kreise aus in denen wir missionieren." Diese Haltung widerspricht zutiefst dem Evangelium. Wir müssen immer im Blick halten, dass wir diejenigen, die durch uns, durch unerleuchtete Pfarrer oder MitarbeiterInnen der Kirche verletzt worden sind, wieder zurückkommen können, wenn sie es wollen, und wir müssen immer das Signal geben, dass wir uns freuen, wenn sie zurückkommen, und dass wir auch bereit und offen dafür sind anzuerkennen, dass wir nicht einfach nur so bleiben können wie wir sind wenn wir wollen dass sie zu uns zurückkehren. Da ist ein tiefer Zusammenhang. Und in diesem Zusammenhang ist es auch wichtig Formen zu finden, wie wir versöhnungswillig Versöhnungswilligen entgegentreten - in kleinen Schritten, so wie es der Fuchs dem kleine Prinz sagt, in kleinen Schritten, nicht sofort miteinander spielen, sondern zunächst Abstand halten, dann einen ersten, zweiten Schritt aufeinander zugehen. Diese Behutsamkeit im Aufeinander zugehen ist ein großer Dienst, der dann weit hinausgeht über das Thema Geld, und der sicherlich auch in der Intention derjenigen ist, die sich eben nach dieser Versöhnung sehnen.
Ein Punkt wurde noch genannt: „Zurückkommen und Erzählen ist so schwer“. Sie machen hier auf der Diözesanversammlung im Rahmen des Prozesses Apg 2010 eine ganz großartige Erfahrung, und dann kommen Sie zurück und sind wieder im Alltag. Das wird auch dann ein Problem bleiben, wenn man nachträglich Artikel veröffentlicht. Das ist eine für die geistliche Unterscheidung wichtige Erfahrung. Ich kenne sie von den Mitbrüdern, die in der Mission sind. Ich verlasse meine Gemeinde, gehe in die Fremde, in der Fremde mache ich Erfahrungen komme mit diesen Erfahrungen zurück und finde in meiner Heimat „taube Ohren“ vor. Das hat zwei Gründe, diese tauben Ohren: Erstens habe ich mich in der Zeit, in der ich draußen war, verändert, ich komme verändert zurück. Zweitens hat sich aber auch die Gemeinde, die ich verlassen habe, entwickelt. Das ist jetzt vielleicht für diesen Prozess hier ein nicht so langer Zeitraum des Abstandes, dass es wesentliche Veränderungen auf dieser Seite sind, aber es ist als Grundstruktur eine Erfahrung von Missionaren. Ich kehre zurück und ich bin am unwillkommensten an dem Ort, von dem ich ausgegangen bin. Deswegen ist das Benennen des missionarischen Aspektes der Kirche so zentral und so wichtig und bleibt es. Wir müssen in unseren Gemeinden den Missionsbegriff so definieren, dass deutlich wird: Liebe Schwestern und Brüder, wenn wir wirklich missionarisch sein wollen, dann müssen wir nicht nur wollen, dass sich die anderen verändern, sondern dann müssen wir auch wenn die anderen zu uns kommen, uns verändern.
Ich möchte noch einen Punkt sagen zum Stichwort Machtmissbrauch: Ich bin vorhin gebeten worden dazu noch ein Satz zu sagen. Ich habe über die sexualisierte Gewalt gesprochen. Das Wort sexueller Missbrauch ist ja bekanntlich ein schwieriges Wort, aber der Begriff des Missbrauchs enthält den wichtigen Aspekt, dass es ja um einen Missbrauch von Macht geht in einer sehr engen Beziehung. Diese Macht wird natürlich auch auf nichtsexuelle Weise missbraucht. Und deswegen stellt natürlich der sexuelle Missbrauch die Kirche auch vor die Frage ihres Umgangs mit Macht - auch außerhalb von sexuellen Kontexten. Hier wäre jetzt dran einen längeren Vortrag zu halten über die Unterscheidung der Geister für diejenigen, die Macht in der Hand haben. Einen Aspekt habe ich ja schon genannt: Macht, die nicht unfrei machen will, sondern die Kirche für den Geist öffnen will, muss Macht sein, die zuhört. Einen zweiten Grundsatz, der mir wichtig zu sein scheint, gerade auch im Umgang mit dem Begriff des „servur servorum“, des Dieners aller Diener lautet: Macht, die absolut ist, kann nicht dienen. Das ist für mich eine wesentliche Erkenntnis der letzten Monate geworden. Macht, die absolut ist, kann nicht dienen, weil sie immer herrschen muss. Und weil sie dieses Herrschen immer versteht als einen Vorgang, der einseitig von oben nach unten geht. Um es anders auszudrücken, ausgehend von meiner Erfahrung als Lehrer und auch als Priester: Als Lehrer habe ich auch Macht. Und der Macht hat, steht geistlich immer in der Versuchung, die Aufmerksamkeit, die ihm auf Grund seiner Amtes entgegenkommt, zu verwechseln mit Aufmerksamkeit, die ihm gegenüber als Person entgegenkommt. Deswegen ist Eitelkeit bei Machtinhabern etwas ganz Gefährliches, weil es sie blind macht dafür, dass sie die Aufmerksamkeit und Zuwendung, die sie bekommen, letztlich wegen ihres Amtes bekommen und nicht weil sie so eine tolle Person sind. Deswegen ist der erste und wichtigste Schritt im Umgang mit Macht die Überprüfung des eigenen Verhältnisses zur Macht: Habe ich wirklich ein geklärtes Verhältnis im Bezug auf das Verhältnis zwischen Amt und Person? Ich halte es für ein grundkatholisches Anliegen, zwischen Amt und Person zu unterscheiden. Alles in unserer Kirche, was zur Verpoppung der Personen, die Amtsinhaber sind führt, führt natürlich zur Vernebelung dieses Unterschiedes. Die katholische Kirche hat immer ein Gespür dafür gehabt, dass amtliche Vorgänge ihre Gültigkeit haben unabhängig von der Glaubwürdigkeit der Person. Unglaubwürdigkeit der Person kann natürlich auch die Glaubwürdigkeit des Amtes verdunkeln und beschädigen, das ist die andere Seite der Medaille. Es geht mir aber hier darum, dass der Amtsträger selbst wissen muss, dass das Amt, das er innehat, nicht dazu führen darf, dass er sich als Person so in den Mittelpunkt stellt, dass daraus die Unterscheidung zwischen Amt und Person nicht mehr im vollen Sinn des Wortes sichtbar wird.
Das Zweite: Wenn das so ist, dann muss Amt Kritik aushalten. Ich habe das Beispiel des Sturms genannt. Ich glaube man kann einen Sturm geistlich nicht lesen, wenn man leicht kränkbar ist. Man muss Kränkung aushalten, man muss Verletzung aushalten können, wenn man Amtsträger ist. Ich habe oft vor Opfern gesessen, die mich so angesprochen haben, als wäre ich der Täter. Da war es für mich ganz schwierig, nicht zurückzurufen und zu sagen: „Hör mal, ich bin kein Täter, ich hab Dir nichts gemacht.“ Sondern ich musste – gerade auf Grund meines Amtes - immer wieder antworten und sagen: „Ja, du bist mit deiner Kritik und deinem Zorn an der richtigen Adresse.“ Und genau das ist das, was das Amt meines Erachtens machen muss, was jeder Lehrer machen muss gegenüber einem Schüler oder einer Schülerin, der ihn anbrüllt, zu sagen: „Ja du bist mit deinem Zorn und deiner Kritik hier an der richtigen Adresse.“ Wenn Kritik Majestätsbeleidigung ist, dann rieche ich die Anfälligkeit für Machtmissbrauch. Das ist auch eine Botschaft, die ich in aller Deutlichkeit allen Hofschranzen sagen muss. Die Verteidigung des gekränkten Amtsinhabers läuft ja nicht durch den Amtsinhaber selbst, sondern durch diejenigen, die meinen, ihn verteidigen zu müssen, weil sie meinen, dass er gekränkt worden ist durch Kritik. Die Hofschranzen machen den Dialog in der Kirche und auch die Möglichkeit, in einer Weise Macht auszuüben, die der Freiheit und der Öffnung der Kirche für den Geist dient, manchmal unmöglich. Sie sind eine schwere Belastung für das Gespräch in der Kirche. -Das zum Thema Machtmissbrauch.- Noch vieles wäre zu sagen, ich möchte zum Abschluss nochmals ein Stichwort aufnehmen, das genannt wurde, dieses „trotzdem in der Kirche sein“. Ich hab das selbst erfahren dürfen in den letzten Jahren und Monaten, in Berlin in einer Stadt, in der die Kirche eine kleine Minderheit ist und in der es auch sehr viel Krawall-Antiklerikalismus etc. gibt. Ich glaube, dass dieses trotzdem... über den Trotz hinausgehen sollte, in dieses Mit-Jesus-auf-dem-Boot- liegen und schlafen. Also sein eigenes Kopfkissen danebenlegen. Es ist eine der wunderbaren Erfahrungen, auf die uns die Kritik von außen an der Kirche hineinführt: wir dürfen uns in diesen Situationen eben nicht nur zu Gott dem Vater im Himmel und zu Jesus Christus bekennen; sondern wir dürfen entscheiden und darüber sprechen, wie wir zur Kirche stehen. Das ist ja die aktuelle Herausforderung. Die Welt, sofern sie uns die Freude an der Kirche austreiben will, und die Kirche selbst in manchen ihrer Repräsentanten, sofern sie uns die Freude an der Kirche tatsächlich auch austreibt, werden es niemals schaffen, unser Bekenntnis zur Kirche aufzulösen. Das alles wird vielmehr dazu führen, dass es mein Bekenntnis zur Kirche vertieft wird.
Oft wurde ich in den letzten Monaten von Journalisten gefragt: Warum treten sie nicht einfach aus? Eine Antwort, die ich gefunden habe und die mir sehr geholfen hat, auch durch die Stürme solcher Interviews hindurchzugehen, lautete: „Für mich ist die Kirche nicht nur die Hierarchie.“ Und das ist auch ein Grund, warum ich nicht austrete. Ich bin gefragt worden: „Werden Sie in der Kirche unterstützt?“ Die, die fragen, haben immer die Hierarchie im Blick, wenn Sie so etwas fragen. Dann hab ich geantwortet: „Die Kirche ist nicht nur die Hierarchie und wir Jesuiten in Deutschland kriegen auch aus der Kirche Große Unterstützung.“ Die Kirche ist die Gemeinschaft der Gläubigen, sie gehört in unser Glaubensgeheimnis eben mit hinein. Ich hatte so viel Gelegenheit in den letzten Monaten mit Leuten, die gegenüber der Kirche ganz fremd sind, über die Kirche zu sprechen, und ringe selbst um eine Sprache, wie ich Menschen, die überhaupt gar kein Verständnis dafür haben, dass man die Kirche lieben kann, warum man das kann. Und das führt zu einer Vertiefung meines Verständnisses von Kirche. Der Grund, warum ich die Kirche liebe, besteht in mehr als nur das was sie mir in meiner Kindheit gegeben hat, ist mehr als nur die Tradition aus der ich lebe, sondern es ist das, was sich mir aus dem Geheimnis der Kirche her enthüllt in dem Maße, in dem ich die Geister unterscheide und spüre, dass die Kirche eben Adressat des Sprechens des Geistes ist. Und wenn wir in DIESER Gegenwart des Geistes leben und sagen, der Geist spricht eben nicht nur zu mir als Individuum, sondern er spricht auch zu uns als Gemeinschaft und vereint uns durch sein Sprechen, dann können wir auch wieder theologisch und religiös über die Kirche sprechen, ohne in diese Verteidigungskämpfe von kirchlichen Phänomenen hineingehen zu müssen, die sich vielleicht gar nicht mehr verteidigen lassen. Herzlichen Dank (P. Klaus Mertes SJ, Berlin) |
| Zurück |